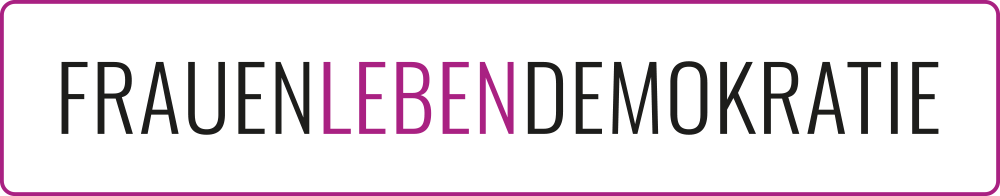Die zentralen christlichen Werte sind für mich Nächstenliebe, Solidarität und Freiheit!
Wir sind zu Hause eine evangelisch geprägte Familie. Als mein Bruder und ich klein waren, gingen wir in einen evangelischen Kindergarten, der direkt neben der Nathanaelkirche stand. Das war in unserem Stadtteil Lindenau (Leipzig) alles eng verflochten. Der Gottesdienst war für alle offen, wir haben viel gesungen und nach dem Kindergottesdient gab es Kirchenkaffee. Wir waren eine richtige Gemeinschaft!
Die zentralen christlichen Werte sind für mich Nächstenliebe, Solidarität und Freiheit. Gleichzeitig merke ich, wie wichtig die soziale Prägung ist. Ich gehe auf eine Montessorischule, da sind auf jeden Fall nicht alle sozialen Schichten vertreten. Wir Schüler gehören zur mittleren bis gehobenen Mittelschicht und es gibt nur ganz wenige, die das Schulgeld vom Amt beziehen. Dadurch entsteht so eine Blase. Wenn ich nicht gleichzeitig in Lindenau wohnen, was ja nicht unbedingt ein Mittelschichtsstadtteil ist, und nicht in meinem Fußballverein spielen würde, würde ich wahrscheinlich kaum andere Lebensrealitäten kennenlernen.
Mein Religionslehrer ist katholisch. Das habe ich mir bewusst so ausgesucht, um auch die andere Konfession richtig kennenzulernen. Ich finde es nicht so wichtig, dass wir alle die gleichen Bibelgeschichten auswendig können, das war im Kindergarten bedeutsam. Im Religionsleistungskurs geht es eher um Fragen der Theodizee und wer ich bin und wann ich mich wie verhalte und warum. Also um Religion im Zusammenhang mit der Welt aus unterschiedlichen Perspektiven. Da erfahre ich auch, wie Nichtchristen darüber denken. Dieser Dialog ist für mich ein weiterer Teil meines Wertekanons.
Heute bin ich froh, dass ich evangelisch bin. In der katholischen Kirche können Frauen zum Beispiel nicht Pfarrerin werden. In meiner Jahrgangsstufe sind Frauen, die katholisch aufgewachsen sind. Dadurch reden wir in der Schule darüber, ob es überhaupt geht, dass man Frauen aus Angst, Macht zu verlieren, so zurückstellt. Das gibt es natürlich in der Gesamtgesellschaft auch, aber nicht in dem Maße. Laut Grundgesetz ist ja jede Frau zumindest befähigt, alles machen zu dürfen. Dass der Glauben das ausschließen soll, geht für mich gar nicht!
Im Januar 2021 schreibe ich mein Abitur und danach möchte ich gern ein Freiwilliges Soziales Jahr Politik machen, zum Beispiel in einer politischen Bildungsstätte oder in einer Landtagsfraktion. Ich habe von meinen Eltern gelernt, dass man nicht einfach die Haustür schließen kann und dann nichts mehr mit der Welt zu tun hat. Man ist eigentlich immer für etwas verantwortlich, denn auch das Private ist politisch!
In Sachsen habe ich schon mal ein Praktikum im Ministerium für Gleichstellung und Integration gemacht, damals noch ein SPD geführtes Ministerium. Nach dem Abitur möchte ich gern etwas Neues kennenlernen.
Lebenswegstation 1
Achtung Alltagssexismus!
Beim Fußball spiele ich in der Abwehr. Ich liebe diese Position, weil ich das Spiel von vorn sehen und es verschieben kann. Das ist am sichersten.
In den gemischten Mannschaften habe ich nicht nur gute Erfahrungen gemacht. So mit elf Jahren fingen die Sprüche gegen die Mädchen in der Mannschaft an. Von meinem Trainer habe ich mich nicht wirklich unterstützt gefühlt, also musste ich selbst kontern. Am Ende bin ich in eine andere Mannschaft gegangen. Dort war ich das einzige Mädchen und etwas jünger als die leistungsstarken Jungs. Die haben mich sehr nett aufgenommen, aber ernst genommen haben sie mich nicht. Sie haben zum Beispiel den Ball durchgedribbelt bis zum Tor, dort auf mich gewartet und dann habe ich ein Tor geschossen. Das war natürlich lustig, aber es war nicht unbedingt das Bild, das ich von Teamsport hatte.
Als ich 16 wurde, wechselte ich in eine reine Frauenmannschaft Ich war die mit Abstand Jüngste in der Mannschaft und musste mir den Respekt der Frauen erst erspielen. Mein Vorteil war, dass die Mannschaft gerade neu zusammengewürfelt wurde: Manche spielten schon -wie ich- seit der Kindheit, andere hatten gerade erst begonnen. Aus dieser bunten Mischung formte sich aber bald ein Team.
Ein Unterschied, der mir im Vergleich mit den gemischten Mannschaften auffällt, ist dass wir Frauen die Anordnungen des Trainers viel mehr hinterfragen: „Wieso machen wir das jetzt eigentlich? Wofür ist das überhaupt gut?“ So was würde in einer Jungenmannschaft niemand sagen. Die machen einfach, was der Trainer sagt.
Lebenswegstation 2
Gott in der Politik
Ich gehe auf das Bischöfliche Maria-Montessori-Schulzentrum Leipzig. Von den zwei christlichen Schulen in Leipzig war diese einfach näher an unserer Wohnung. Viele Eltern schicken ihre Kinder aber vor allem dorthin, weil es eine Montessorischule ist.
Im Religionsunterricht reden wir nicht mehr über Bibelgeschichten, sondern über die Gerechtigkeit Gottes im Zusammenhang mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen. Die Frage, ob die Geschäfte in Zukunft auch sonntags offen haben sollen, verstehe ich zum Beispiel nicht! Der Sonntag ist natürlich ein christlicher Tag, aber auch Nicht-Christen müssen mal zur Ruhe kommen und sich besinnen.
Ich glaube, dass es besser für eine Gesellschaft ist, wenn sonntags alle frei haben, so dass Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zusammenkommen können, die unterschiedliche Berufe ausüben und unterschiedliche Hobbies haben. Sonst haben sonntags vor allem die Chefs frei und können Tennis oder Fußball spielen oder schwimmen gehen. Die Angestellten dagegen müssen nach dem Dienstplan gehen und haben dann höchstens am Montag frei.
Lebenswegstation 3
Privat ist politisch!
Meine Mutter ist aus dem Westen und mein Vater aus dem Osten. Ich bin 2002 geboren, aber ich finde schon, dass man die Ost-West-Unterschiede gerade in Sachsen noch richtig merkt. Irgendwann habe ich mal beim Schreibtisch aufräumen einen Schmierzettel gefunden, auf dessen Rückseite die Zeitungsannonce der Hochzeit meiner Eltern gedruckt war. Ich fand es cool, wie sie selbst ihre Hochzeit politisch genutzt haben. In der Annonce steht, dass sie sich keine Geschenke wünschen, sondern möchten, dass Geld für eine verbesserte Ost-West-Kommunikation gespendet wird.
Durch die Besuche meiner Großeltern in Niedersachsen weiß ich, dass Nachwende-Geborene in westdeutschen Kleinstädten die kulturellen Unterschiede zwischen Ost und West, wenn überhaupt, lustig finden: „Oh, eine ostdeutsche Frau, die hat ja die Hosen an!“ Aber was soll denn das sein, die Hosen anzuhaben? Ich fände es besser, wenn man die strukturellen Unterschiede ehrlich benennen würde! In unserer Familie haben wir dafür einen eigenen Humor. Mein Opa fragt bis heute bei jedem Besuch, ob wir gut über die Grenze gekommen sind.