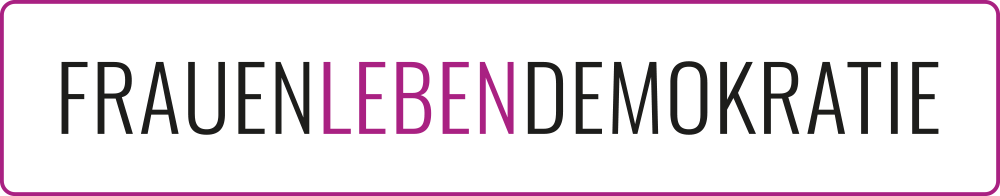Ich bat Gott, für mich zu sorgen!
Ich wurde 1977 in Marienberg (Sachsen) in eine Familie geboren, die sich immer stärker in Opposition zum Unrechtstaat begab. Meine Eltern entschieden sich dennoch bewusst gegen einen Ausreiseantrag. Wenn man was verändern wollte, dann musste man bleiben!
Der christliche Glaube gehörte von Beginn an zu meiner Identität. Doch mit 13 Jahren stellte ich das zum ersten Mal in Frage. Ich haderte mit Gott und dem Gefühl, falsch für ihn zu sein, denn ich bin alles andere als eine fromme Maria. Ich bin Esther.
Erst mit der Zeit verstand ich, dass meine Durchsetzungskraft und mein starker Wille wohl ihren Sinn haben.
Nach dem Abitur ging ich auf ein Wanderjahr quer durch Deutschland. Die Frage, wo komme ich heute Abend unter, stellte sich jeden Tag neu, aber mit meinen Sorgen konnte ich sie nicht lösen. So gab ich sie an Gott ab und bat ihn, für mich zu sorgen. Und jeden Abend war etwas für mich vorbereitet: ein Schlafplatz, eine Mahlzeit, freundliche Menschen. Seither bin ich wacher für diese inneren Ahnungen und die äußeren Fügungen, in denen ich Gottes Stimme zu hören glaube.
Im Februar 2000 pilgerte ich auf dem Jakobsweg in Spanien von León nach Santiago de Compostela. In der Herberge von Hospital de Órbigo entdeckte ich auf einer Europakarte, dass die gewachsene Handelsstraße Via Regia auch durch Mitteldeutschland führt. Am nächsten Morgen war die Idee geboren, die Via Regia als Pilgerweg in Deutschland wiederzubeleben. Diese Verantwortung ließ mich einen Moment zögern, doch der Weg öffnete sich beim Gehen.
Die Robert-Bosch-Stiftung war bereit, mir ein Freiwilliges Soziales Jahr für dieses Projekt zu finanzieren, das Landesjugendpfarramt in Dresden stellte mir die Infrastruktur. So konnte ich die Spendengelder akquirieren, den Weg erkunden, die Ausschilderungen genehmigen lassen, Herbergen finden und einen Pilgerführer schreiben. Irgendwann war die Fülle der Aufgaben so erdrückend, dass ich nicht mehr schlafen, essen oder arbeiten konnte. Ich betete Psalmen und rief verzweifelt zu Gott „Du wolltest doch, dass ich das mache!“ Irgendwann vernahm ich in mir die Antwort: „Du musst nicht mehr tun, als Du kannst!“
Eigentlich sollte ich 2003 als Jugendwartin die christliche Jugendarbeit im Kirchenbezirk Großenhain (Sachsen) koordinieren, doch mein Mann Alexander erhielt die Stelle des Konzertmeisters in Würzburg. Ich verließ schweren Herzens den Osten, obwohl es mir wie Landesverrat erschien. Wir zogen nach Franken. In den ersten zwei Jahren hatte ich das Gefühl, nicht in dieser „fetten“ Erde wurzeln zu können. Heute denke ich, wo man mit Menschen zu tun hat, ist man nötig und richtig!
Quellenangaben: Portrait Esther ZeiherLebenswegstation 1
Schwere Glaubensprüfungen!
Im Haus meiner Eltern war Kirche immer dann, wenn Menschen spontan zusammenkamen, um ihren Glauben zu teilen, gemeinsam zu erzählen, zu beten und zu singen. Meine Eltern lebten aus den Worten der Bibel. Meine Mutter wurde für viele zur Seelsorgerin, mein Vater stärkte junge Menschen im Glauben. Vor allem die christlichen Soldaten der NVA-Garnison in Marienberg nutzten unser Haus als geistige Zuflucht.
1980 wurde mein Bruder Stefan wegen Staatsverleumdung (§220 StGB) und 1981 auch meine Schwester Susanne wegen versuchter Republikflucht verurteilt. Meine Schwester wurde nach einem Jahr sehr harter Hafterfahrung in der Strafvollzugseinrichtung Stollberg (Hoheneck) in die Bundesrepublik freigekauft. Sie lebt heute in Guatemala.
Obwohl ich selbst noch ein Kind war und meine Eltern es sehr gut verstanden, mich von der Dramatik der Situation fernzuhalten, habe ich aus dieser Zeit dennoch mitgenommen, dass man in jeglicher Unterdrückungssituation die Würde als Mensch bewahren und aufrecht und ungebeugt bleiben muss!
Lebenswegstation 2
Emanzipation im Glauben!
Das Bindeglied zwischen meinen Eltern war der Glauben und das Wissen, in der DDR bleiben zu wollen. Das Evangelium muss von unten kommen und niemals von oben, war einer der Glaubenssätze meines Vaters. Er hat oft Briefe geschrieben und gefordert, dass die Pfarrer lauter von der Kanzel predigen und auch der Landesbischof Position bezieht. So erlernte ich leichte Vorbehalte gegenüber der Amtskirche in der DDR. Erst später habe ich erfassen können, dass sich die Institution Kirche in der DDR in gewisser Weise kompromissbereit zeigen musste, um die Gesprächsfähigkeit mit dem Staat aufrecht zu erhalten. Auf eine gewisse Art war sie viel zu zahm.
Heute lebe ich in Franken. Um weiter an einem christlichen Gymnasium als Religionslehrerin unterrichten zu dürfen, wurde mir vorgeschlagen, im Quereinstieg -als sogenannte Pfarrverwalterin- Pfarrerin werden. Ich habe lange mit mir und meiner elterlichen Prägung gerungen: in einem Talar auf einer Kanzel zu stehen und zu predigen, war eine biographisch vorbelastete Vorstellung. Doch mein Mann Alexander hat diesen Weg von Anfang an unterstützt.
Heute bin ich dankbar für das neue Feld, dass sich mir eröffnet hat.
Lebenswegstation 3
Heimat als Ort
Als junges Mädchen führte ich kurz nach der Wende Touristen durch die Annenkirche in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge). Die Reisegruppen aus dem Westen staunten immer wenn ich sagte, dass die Wende das Beste sei, was uns passieren konnte, weil wir nun endlich frei wären und überall hinreisen könnten. Das hatten sie von den älteren Generationen im Osten bisher so nicht gehört.
Zu dem Zeitpunkt lag die Arbeitslosigkeit in Sachsen gerade unter den Frauen um die 50 bei 20%. Da für die öffentlichen Ämter politisch unbelastete Menschen gesucht wurden, kam meine Mutter als Gleichstellungsbeauftragte ins Landratsamt. Sie entwickelte Angebote, wie speziell Frauen sich diese schwierige Lebensphase schön einrichten können.
Ich selbst hatte sicher das Glück, so jung zu sein, aber ich sehe auch die Scherben, die in den älteren Generationen im Zuge der Wende entstanden sind. Heute bin ich stolz auf meine Familiengeschichte. Aber ich bin auch stolz, dass ich sie jetzt anders weiterschreiben kann.
Wir, die wir heute im Westen leben, können auch sehr viel verändern!